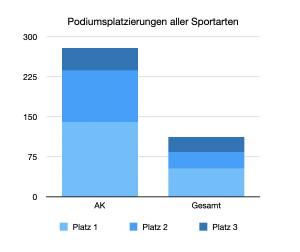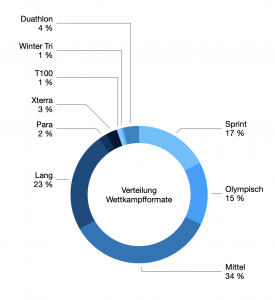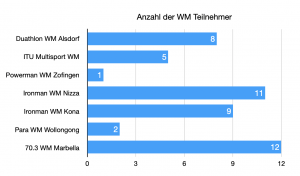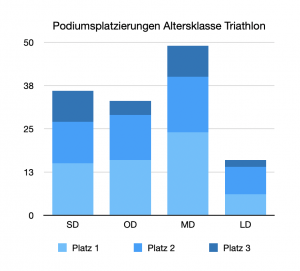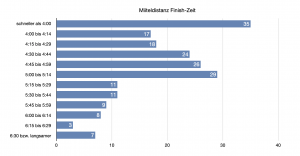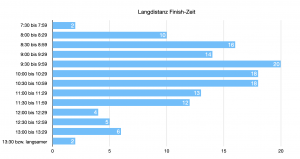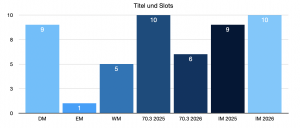Fingerpaddles im Schwimmtraining für Triathleten – sinnvolles Techniktool oder trügerische Hilfe?
Fingerpaddles erfreuen sich im Schwimmtraining von Triathleten zunehmender Beliebtheit. Sie sind klein, leicht, scheinbar schonend für Schulter und Ellbogen und sollen gezielt die Wasserlage der Hand verbessern. Doch bei genauerer Betrachtung erfüllen sie viele dieser Versprechen nur bedingt – und können technische Fehler sogar verstärken, statt sie zu korrigieren.
Dieser Artikel beleuchtet kritisch, was Fingerpaddles tatsächlich bewirken, wo ihre Grenzen liegen und wie sie sich im Vergleich zu klassischen Handpaddles schlagen.

Was sind Fingerpaddles – und was sollen sie bewirken?
Fingerpaddles liegen ausschließlich über den Fingern, nicht jedoch über der gesamten Handfläche. Die Idee dahinter:
Der Schwimmer soll „mehr Gefühl für das Wasser“ entwickeln und lernen, Druck besser über die Finger aufzubauen.
Die beworbenen Effekte:
•Verbesserte Wahrnehmung der Wasserlage
•Förderung einer sauberen Druckphase
•Geringere Belastung für Schultern als bei großen Paddles
•Technikfokussierter Einsatz statt Krafttraining
Klingt gut – in der Praxis sieht das jedoch differenzierter aus.
Das zentrale Problem: Fingerpaddles fördern falsche Handgelenkstellungen
Ein entscheidender Schwachpunkt von Fingerpaddles liegt in ihrer biomechanischen Wirkung auf das Handgelenk.
Sie fördern das Abknicken – statt es zu verhindern!!!
Statt eine stabile, neutrale Handhaltung zu unterstützen, begünstigen Fingerpaddles oft:
•das Abknicken des Handgelenks nach hinten
•eine passive Druckführung
•den Kraftansatz über die Finger statt über Unterarm und Handfläche
Da der Widerstand ausschließlich an den Fingern angreift, entsteht ein unnatürlicher Hebel, der das Handgelenk in die Überstreckung zwingt. Der Athlet hat das Gefühl, „Wasser zu greifen“, trainiert aber tatsächlich eine mechanisch ungünstige Position.
Das Ergebnis:
•Fehlbelastung des Gelenks
•geringerer Effekt für den Vortrieb
•erhöhtes Risiko für Sehnen- und Gelenkprobleme im Dauertraining
•Übertragung einer schlechten Technik in das Paddles-freie Schwimmen
Kurz gesagt:
Fingerpaddles fördern nicht die korrekte Armzugmechanik – sie können sie verfälschen.
Für Triathleten besonders problematisch, denn Triathleten haben meist:
•begrenzte Zeit für Techniktraining
•schwächere wasserbezogene Muskulatur
•weniger Routine im Wasser als reine Schwimmer
•höhere Verletzungsanfälligkeit durch hohe Gesamtbelastung
Gerade deshalb benötigen sie saubere Bewegungsmuster und Tools, die Korrektheit fördern – nicht Kompensation.
Fingerpaddles hingegen:
•suggerieren Technikverbesserung ohne echte Korrektur
•kaschieren strukturelle Defizite
•fördern ineffiziente Zugmuster
Für Technikarbeit sind daher sinnvoller:
•Sculling-Drills
•Einarmübungen
•Paddles mit kleiner Fläche
•Technikschwimmen ohne Hilfsmittel
•Videoanalyse oder Trainerfeedback
Fazit: Fingerpaddles sind kein ideales Werkzeug für Techniktraining
Auch wenn Fingerpaddles populär sind und sich „leicht“ anfühlen – ihr Nutzen ist begrenzt und ihr Risiko nicht zu unterschätzen.
Kritische Schlussbewertung:
•Sie verhindern kein Abknicken des Handgelenks – sie fördern es
•Sie verbessern das Wassergefühl nicht zwangsläufig
•Sie ersetzen kein echtes Techniktraining
•Sie liefern ein falsches Bewegungsfeedback
•Ihr Effekt ist mehr Illusion als Leistungsfaktor
Für Triathleten, die ökonomisch, stabil und verletzungsfrei schwimmen wollen, sind sie daher kein empfohlenes Trainingswerkzeug.
Deutlich sinnvoller:
•klassisch kleine Handpaddles
•Technikdrills ohne Hilfsmittel
•gezielte Wasserlageübungen
•saubere Kraftübertragung über Unterarm und Handfläche
Fingerpaddles im Brustschwimmen – eingeschränkt sinnvoll
Wenn Fingerpaddles überhaupt sinnvoll einsetzbar sind, dann eher im Brustschwimmen. Dort ist ein stärker angewinkeltes Handgelenk Teil der Technik, sodass die durch Fingerpaddles begünstigte Stellung weniger problematisch ist als im Kraul. Der Widerstand an den Fingern kann helfen, den Druck nach außen besser zu spüren.
Dennoch gilt auch hier: Fingerpaddles fördern kein sauberes Technikbild und ersetzen kein strukturiertes Techniktraining. Ihr Nutzen bleibt begrenzt und sollte nur ergänzend gesehen werden.
Studienlage zu Fingerpaddles
Leider gibt es keine wissenschaftlichen Arbeiten, die sich explizit mit dem Thema Fingerpaddles beschäftigen, so dass meine Beobachtungen hierzu erfahrungbasierte Beobachtungen aus fast 10000 Stunden Arbeit seit 2004 am Beckenrand primär mit Age Group-Triathleten sind.
Weiterführende Quellen zu Paddles im Kraulschwimmen:
Gourgoulis, V., Boli, A., Aggeloussis, N., Toubekis, A., Antoniou, P., Kasimatis, P., & Mavromatis, G. (2008).
Hand orientation in hand paddle swimming. International Journal of Sports Medicine, 29(5), 429–434. https://doi.org/10.1055/s-2007-965337
Gourgoulis, V., Aggeloussis, N., Mavromatis, G., & Garas, A. (2006).
Effect of two different sized hand paddles on the front crawl stroke kinematics. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 46(2), 232–237.
Payton, C. J., & Lauder, M. A. (1995).
The influence of hand paddles on the kinematics of front crawl swimming. Journal of Human Movement Studies, 28, 175–192.
Lauder, M. A., Dabnichki, P., & Bartlett, R. M. (2001).
Improved accuracy and reliability of sweepback angle, pitch angle and hand velocity calculations in swimming. Journal of Biomechanics, 34(11), 1459–1466. https://doi.org/10.1016/S0021-9290(01)00122-2
de Matos, C. C., Barbosa, T. M., Daly, D., & Costa, M. J. (2023).
Effects of paddles and fins on front crawl kinematics, arm stroke efficiency, coordination, and estimated energy cost. Frontiers in Physiology, 14, 10240615. https://doi.org/10.3389/fphys.2023.10240615
Espinosa, D., Arellano, R., Sánchez-Molina, J., & Cuenca-Fernández, F. (2025).
Swimming performance with fins, hand paddles, and no equipment. Comptes Rendus Biologies. (Advance online publication)
Matos, C. C., Barbosa, T. M., & Costa, M. J. (2013).
The use of hand paddles and fins in front crawl: A literature review. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, 15(5), 653–664.
Lauder, M. A. (2009).
Asymmetry in front crawl swimming with and without hand paddles. In Biomechanics and Medicine in Swimming XI (pp. 158–161). Norwegian School of Sport Sciences.
Samson, M., Deschodt, V., Bernard, A., Monnet, T., Lacouture, P., & David, L. (2015).
Kinematic hand parameters in front crawl at different paces. Journal of Biomechanics, 48(12), 3874–3880. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2015.09.007
Koga, D., Kubo, Y., Ikeda, S., & Homma, M. (2022).
Relationship between hand kinematics, hydrodynamic pressure distribution, and hand propulsive force in front crawl. Frontiers in Sports and Active Living, 4, 899375. https://doi.org/10.3389/fspor.2022.899375
Gourgoulis, V., Aggeloussis, N., Toubekis, A., Antoniou, P., & Mavromatis, G. (2010).
Kinematic characteristics of the stroke and orientation of the hand during front crawl resisted swimming. Journal of Sports Sciences, 28(11), 1179–1188. https://doi.org/10.1080/02640414.2010.497822